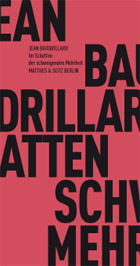Masse - Religion - Gewalt
Neue Publikationen von Jean Baudrillard und René Girards bei Matthes & Seitz Berlin
Der französische Soziologe Jean Baudrillard war Zeit seines Lebens ein Verführer. In späteren Schriften betonte er dies selbst, nachdem er seit 1979 die 'séduction' zu einem seiner Schlüsselbegriffe und seiner schillerndsten Denkfigur gestaltet hatte. Retrospektiv lässt sich kaum ein Text von Baudrillard unabhängig von diesem Modell lesen, denn so funktioniert seine Argumentation: Als mitreißender Rausch der Verknüpfungen, die den Gegenstand strudelartig umkreisen, um schließlich kaum einen Ausweg zu lassen. So funktioniert auch ein weitgehend vergessener Text von Baudrillard, "Im Schatten der schweigenden Mehrheit oder Das Ende des Sozialen", den der Berliner Matthes & Seitz-Verlag nun in der kleinen Schriftenreihe erneut zugänglich macht.
Ob "Im Schatten" nun eine der "konzisesten und wichtigsten Abhandlungen" (Stephan Günzel) des Autors ist, mag man diskutieren, es ist aber erstaunlich, wie erschreckend aktuell und radikal diese Ideen noch heute sind: Es geht Baudrillard hier um die Macht der Masse, die er als den Endpunkt des Politischen und Sozialen begreift, als ein alles absorbierendes und zur Implosium drängendes "schwarzes Loch". Damit steht er noch heute (oder wieder) in einem radikalen Widerspruch zur idealistischen Linken, denn er gesteht der Masse keinerlei poltisches 'Bewusstsein' oder gar revolutionäres Potential zu: "Die Masse absorbiert alle soziale Energie, ohne irgendetwas davon zu reflektieren. Sie absorbiert alle Zeichen und allen Sinn, gibt aber nichts zurück. Sie absorbiert alle Botschaften und verdaut sie. Auf alle ihr gestellten Fragen gibt sie eine tautologische und zirkuläre Antwort. Sie beteiligt sich nie." (S.34-35) Sie sei "die Umkehrung jedes Sozialismus" (S. 57). Solch radikaler Deutlichkeit bedient sich heute keiner der gehypten oder selbsterklärten Debattenführer, obwohl der Schatten der "Spaßkultur" auch über dieser Idee einer schweigenden Mehrheit liegt.
Ungeachtet anderer Totalitarismusmodelle, die in der vermeintlioch führbaren Masse einen Hort der (positiven) Veränderungen sehen wollen, bleibt Baudrillard hier pessimistisch, den "die Masse schweigt, wie Tiere schweigen" (S. 35). Daher kann man die Masse nur testen, nie jedoch auf eine klare Antwort hoffen. Diese Idee vom Ende des Sozialen ziele letztlich auf eine "Pataphysik des Sozialen, die uns die ganze lästige Metaphysik des Sozialen endlich vom Hals schaffen würde." (S. 41) Schließlich begreift der Autor die Masse selbst als ein Medium, allerdings auch hier: ein Medium, das andere Medien absorbiert und vereinnahmt. Daraus entsteht das Gegenteilt vom modernen Diktum der Individualität: die "Hyperkonformität" (S. 48ff.).
Ab Seite 56 kommt Baudrillard auch auf "Masse und Terrorismus" zu sprechen, was seinem Aufsatz endgültig Kontinuität verleiht, wobei er auch hier keinerlei revolutionären Impuls am Werk sieht, denn "für den blinden, nicht repräsentativen, sinnentleerten Charakter des Terrorakts gibt es kein anderes Äquivalent als das blinde, sinnentleerte, nicht repräsentierbare Verhalten der Massen." (S. 60) Neuere Filme über den Terrorismus wie CARLOS von Olivier Assayas scheinen diesen Blick auf den Terrorismus zu teilen, der kein politisches Statement sein kann, sondern gerade in der Verneinung aller Werte und Institutionen bestehe - und letztlich ohnehin nur durch die Schockwellen in den Medien deutlich werde. Übertroffen werde er noch von der Naturkatastrophe, die zum "mythischen Ausdruck der Katastrophe des Sozialen" (S. 66) werde. Solche Ideen von 1978 erscheinen geradezu unheimlich angesichts aktueller Entwicklungen (2010) und wurden von Baurillard selbst nach dem Anschlag von 11.9.2001 wiederholt.
Ergänzt wird der kleine aber höchst lesenswerte Band durch ein Nachwort von Stephan Günzel, das auf dem kürzlich erschienen Sammelband "Baudrillard fassen" (2009) basiert und einige interessante Bezüge (u.a. zu Karl Marx und Ernst Jünger) herausarbeitet. Und angesichts des umfassenden Fatalismus' der vorliegenden Thesen, die der Masse alle jene Qualitäten absprechen, die noch Wilhelm Reich (in einem negativen Sinne) darin zu erkennen glaubte: ein "Massenbegehren, geführt zu werden." Wenn schon kein Theorem, so ist das zumindest die Basis eines nicht zu vergessenden Diskurses...
Eine geradezu frappierende Ergänzung zu diesen Thesen bildet die von Wolfgang Palaver herausgegebene Beitragssammlung "Gewalt und Religion. Ursache oder Wirkung?", die Aufsätze und Gespräche mit dem französisch-amerikanischen Kulturwissenschaftler René Girard enthält, die um das Bedingungsverhältnis von Religion und Gewalt kreisen (auch hier lauert der Terrorismus um die Ecke, wird aber recht spät im Text erst zum Thema). Girard wurde berühmt durch seine Untersuchung "Das Heilige und die Gewalt", wo er seine elementaren Thesen vom 'mimetischen Begehren' der Massen, der Gewalt des Opfers, der Sündenbockmechanismen und des apokalyptischen Denkens bereits entwickelt hatte. Für Girard ist die Entstehung von Opferriten kulturstiftend, und der Opfermechanismus selbst durch den mimetischen Impuls der Menschen zu erklären: durch (symbolische) Nachahmung streben sie nach der zyklisch wiederholbaren Neukonstitution ihrer Gemeinschaft. Und während in heidnischen Kulten das Opfer noch selbst als 'schuldig' begriffen wird, ist das in den großen monotheistischen Relgionen, namentlich dem judeo-christlichen Bereich, einer Verschiebung gewichen: hier ist das Opfer unschuldig, die Perspektive verschiebt sich von den Opfernden auf das Opfer selbst.
In zwei langen Gesprächen nähert sich Palaver Girards Theorien an, auch andere Schriften kommen hier zur Sprache, speziell aus der Weltliteratur. Das gibt Girard die Möglichkeit, seine differenzierte Opfertheorie auch an westlichen Kulturgütern zu beleuchten (u.a. an Goethes "Wahlverwandtschaften"). Es wird deutlich, wie nah sich Girard Nietzsche fühlt, auch wenn der letztlich entschieden habe, auf der Seite des Opfernden und damit der Mythologie zu bleiben (S. 53ff.). Hier sieht Girard auch einen Schlüssel zur Deutung des 'totalitären Heidentums' etwa im Nationalsozialismus (S. 56ff.).
Die Sündenbockmechanismen dagegen sind Teil des Sozialen geworden, wenn auch in Transformationen - hier ergänzt sich das Modell mit Baudrillards Idee von der Masse 'die sich selbst genügt', die nach Girard 'mimetisch' agiert und daher das Nichtkonforme ausgrenzt und zum potentiellen Opfer (Sündenbock) erklärt, das im Akt des kollektiven Opferritus' die Gemeinschaft rekonstituiert. Den Terrorismus sieht Girard nicht als direkte Folge des Monotheismus, sondern als "Entfesseln einer lange unterdrückten Grausamkeit, unterdrückt nicht durch Christlichkeit, sondern durch die schlimmere Grausamkeit nominell christlicher Mächte. Der Terrorismus ist nur möglich, wenn die potenziellen Täter Gelegenheit haben, sich zu opfern, um andere zu töten." (S. 79) Wichtig sei nach Girard immer wieder - auch im Islam - wie mythische Schüsseldramen von Opferhandlungen interpretiert werden (etwa Abraham und Issak): "Ob das Opfer unschuldig oder schuldig war, und ob sich der Standpunkt des Mobs oder der des Opfers durchsetzt." (S. 80)
Der Verlag Matthes & Seitz Berlin knüpft mit seiner Taschenbuchreihe, in der auch diese beiden Bände erschienen sind, an eine weitgehend vernachlässige Tradition der intellektuellen Kultur an: die Debatte, die durch essayistische Akzente in ihrem Diskurs stimuliert wird. Bleibt zu hoffen, dass diese Akzente möglichst viel Gehör finden.
Marcus Stiglegger
http://matthes-seitz-berlin.de